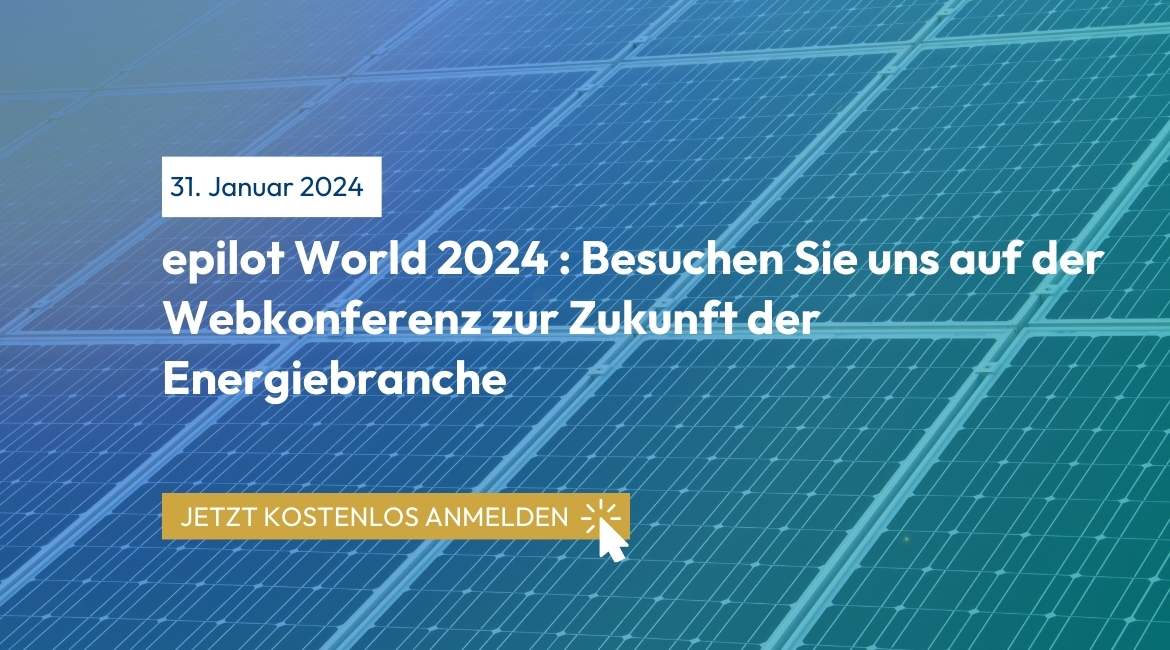Dynamischer Tarif: Einführung für Utilities im Gesamtpaket
Effiziente Anmeldung von Erzeugungsanlagen und Netzanschlussprüfung
Emissionen, Energie- & Ressourcenverbrauch in der Produktion visualisieren und prognostizieren
Fehlerfälle in Ablesung, Abrechnung und Faktura in Rekordzeit erkennen und lösen
SAP S/4HANA for Utilities Einführung: ganzheitlich und strategisch
Smart Metering: Einführung & Betrieb von intelligenten Messsystemen
Testing Insights: Fehler finden, Qualität sichern
Alle Herausforderungen